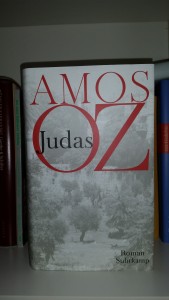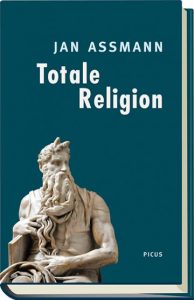Franz Fanon, Die Verdammten dieser Erde, Suhrkamp
Jill Lepore, Diese Wahrheiten, C.H. Beck
Aus aktuellen Anlass Frantz Fanon gelesen. In seinem 1961 erschienen Buch “Die Verdammten der Erde” schrieb er über die Kolonisierten und Unterdrückten:
“Das kolonisierte Volk erlebt es, dass die Gewalt…positive und aufbauende Züge annimmt. Die gewalttätige Praxis wirkt integrierend, weil sich jeder zum gewalttätigen Glied der großen Kette macht, die als Reaktion auf die primäre Gewalt des Kolonialisten und Unterdrückers aufgestanden ist…Auf individueller Ebene wirkt die Gewalt entgiftend. Sie befreit den Kolonisierten und Unterdrückten von seinen verzweifelten Haltungen und rehabilitiert ihn in seinen eigen Augen.”
Zugegeben, Fanon ist keine leichte Lektüre. Um es für wohlstandsverwahrloste, weiße Europäer überhaupt genießbar zu machen, hatte Suhrkamp der Kampfschrift des in Martinique geborenen Anitkolonialisten damals ein Vorwort von Satre beigegeben. Was bezeichnend ist für das europäische Selbstverständnis.
Was Fanons Buch plötzlich wieder so aktuell macht, ist seine Kompromislosigkeit. Es gibt die Unterdrücker und die Unterdrückten. Zwei Parteien ohne die geringste Schnittmenge. Denn der Unterdrückte, hat er sich nur lange genug in dieser Postion befunden, will sich nicht mehr mit dem Unterdrücker verständigen. Er will schlichtweg seinen Platz einnehmen. Er will die Verhältnisse umkehren, denn das ist, was ihn der Unterdrücker all die Jahre, Jahrezehnte und Jahrhunderte gelehrt hat: Es gibt kein Miteinander auf Augenhöhe.
Parallel las ich weiter in Jill Lepores Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika und mittlerweile auf Seite 400 angelangt wird einem klar, wie tief, tief, tief das Rassenproblem in der US-Amerikanischen Gesellschaft verankert ist. Von dem Ringen um eine gemeinsame Verfassung, über die Sezession und den darauf folgend Bürgerkrieg bis hin zu den anschließenden Debatten um Bürgertum, Wahl- und Einwanderungsrecht – immer stand die Rassenfrage entweder im Mittelpunkt, oder aber als Elefant im Raum. Und selbst aus heutiger Sicht progressiv erscheinende Bewegungen, vielfach von Frauen angeführt, die dafür kämpften, Gleichberechtigung und Wahlrecht für ihresgleichen zu erzwingen, bezogen in der sogenannten Rassenfrage den gleichen Standpunkt wie ihre politischen Gegner und wollten die Schwarzen am liebsten allesamt zurück nach Afrika verschiffen.
So erscheint mir Trump heute als ein Wiedergänger aus einer Zeit, in der selbst der Oberste Gerichtshof der USA bestätigte, dass Schwarze Menschen zweiter Klasse seien, von Gott dazu ausersehen, vom weißen Mann beherrscht zu werden.
Das ist im Übrigen die Grundmelodie des Kolonialismus und der von Europa ausgehenden Unterwerfung: Ein Überlegenheitsdenken, das einen Großteil seiner Energie aus dem Auserwähltseinsnarrativ der christlichen Weltdeutung schöpfte. In dem Film “Mission” von Roland Joffé, der im heutigen Brasilien spielt, gibt es eine Szene, in der ein junger Eingeborener vor einer Horde Priester und Conqistatoren auf betörend schöne Weise ein Kirchenlied singt. Und die Herren diskutieren darüber, ob das “Ding”, das da nun so schön gesungen hat, eine Seele habe. Sie kommen zu dem Schluss, dass dem nicht so sei, was ihnen die Hinschlachtung tausender Indios wesentlich erleichterte.
Natürlich kann man sich fragen, was die Wut und die Gewalt der Protestierenden in den amerikanischen Stätten bewirken soll, wenn sie sich doch zum Teil gegen sich selbst richtet. Viel wichtiger aber ist die Frage, wo die Ursachen dieser Ausbrüche liegen und warum die Bilder plündernder Demonstranten in den Medien so viel gegenwärtiger sind, als diejenigen friedliche Protestierender, die im Augenblick jedenfalls noch die überwiegende Mehrheit bilden.