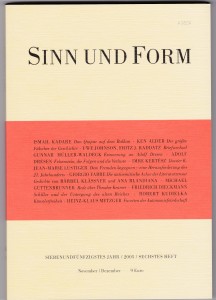Wer sich nichts vormachen lässt, irrt umher.
Lacan
Tief ist das Meer des Lebens. Sollte man es nicht
unerforschlich nennen?
Flechtet man in dieses Bild nun noch Inseln und Kontinente
hinein, dann sind diese Orte des Wissens, des Glaubens, der Zuversicht und der Gefangenschaft.
Das Meer ist Leben in Bewegung. Bewegung weg von etwas und gleichzeitig
hinstrebend zu Anderem. Vergangenheit und Zukunft. Wer irgendwo ankommen will,
muss sich zunächst auf den Weg machen. Nur so viel steht fest: Was hinten liegt,
treibt nach vorne. Was dieses Vorne ist, kann der Reisende meist nur erahnen. Solange
man unterwegs ist, hat man noch nicht verloren. Am Grunde des Meeres liegen
Hoffnungen und Pläne und schauen sehnsüchtig auf die Schiffsbäuche, die über
ihnen einherfahren, als gäbe es dieses Unten nicht, an dem sie sich befinden.
Manchmal schicken sie Blasen noch oben, wenn sie verwesen oder sich vor Reue
krümmen und Schreie ausstoßen. Man sollte oben bleiben, weiterfahren und nur an
Land gehen, wenn man sich absolut sicher ist.
*
Bei Dante leidet Odysseus im Höllenkreis, der für die falschen Ratgeber vorgesehen ist. Gelehrte und Schriftenforscher (so erzählt es uns Borges) sind sich uneins, ob er diesen Platz seiner List, mit der Troja eingenommen wurde verdankt, oder dem Umstand, dass er seine ihm Getreuen zu einer letzten Fahrt überredete, weit über die Säulen des Herkules hinaus, dorthin, wo noch nie ein Menschen gewesen war. An einem hohen Berg schließlich, der sich weit im Süden aus dem Meer erhob und den die Reisenden zunächst als ihre Rettung ansahen da sie Monate lang auf offener See umhergeirrt und völlig mutlos waren, ereilte sie ihr Schicksal in Form eines gewaltigen Sturmes, der das Schiff sinken und seine Mannschaft ertrinken ließ. Christliche Kommentatoren vermuten, dass es sich bei dem Berg um das Fegefeuer handelte, so wie Dante es beschrieb und die Vermessenheit des Odysseus sich diesem zu nähern, mit dem Tode bestraft wurde. Gott, so scheints, sind die von Menschen aus Neugier unternommenen Fahrten ins Ungewisse (Odysseus selbst sagt zu Vergil, er habe die Reise getan, um Tugend und Erkenntnis zu suchen) nicht recht. Aber auch solche, die aus den falschen Gründen unternommen werden. Als der Prophet Jona den Auftrag erhält, der Stadt Ninive das göttliche Strafurteil zu verkünden, besteigt er ein Schiff, das ihn in die entgegengesetzte Richtung, nach Spanien bringen soll. Voller Zorn lässt Gott das Meer aufkochen, welches sich erst wieder beruhigt, nachdem die Matrosen Jona über Bord geworfen haben. In Welten, die von Göttern bewohnt sind ist das Reisen, zumal auf dem Meer, ein gewagtes Unterfangen und man sollte sich gut mit ihnen stellen. Auch der heilige Paulus erlitt auf seiner letzten Reise Schiffbruch, aber da er mit dem Segen des Herrn unterwegs war, konnten ihm die Elemente nichts anhaben.
*
Mitschnitt Interview Samuel T., Projekt:
Aussteigergeschichten – Schwerpunkt religiöse Sondergemeinschaften, Betsy
Schwindelig, freie Journalistin. 02.02.2019
BS: Wieso
Scham?
ST: Weil man plötzlich feststellt, wie fragwürdig alles ist, was man all die Jahre geglaubt hat. Nicht nur in moralischer Hinsicht, sondern auch in intellektueller. Man kommt sich so vor, als hätte man bis zum Alter von vierzig Jahren noch an den Weihnachtsmann geglaubt.
BS: Sie vergleichen den Glauben an Gott mit
dem an den Weihnachtsmann?
ST: Nicht den Glauben an sich. Viele
Menschen glauben an Gott, so wie sie drei Mal auf Holz klopfen. Es ist ein
Glaube ohne Eigentümer. Das heißt, die Irrrealität wird anerkannt, aber gerade
dadurch kann man daran festhalten. Es kommt nicht zu kognitiven Dissonanzen.
Für uns dagegen war alles was Gott betraf real. Jedes Wort in der Bibel wurde für
bare Münze genommen. Von der Erschaffung der Welt in sieben Tagen, über den
Sündenfall in Eden, die weltweite Flut, die nur ein mit Tierpaaren gefülltes
Boot überstand, Feuer und Schwefel vom Himmel, eine Sonne, die am Himmel stehen
bleibt bis hin zu den Geschichten über Jesus und seine Wunder. Und natürlich
auch das Ende mit seinen apokalyptischen Prophezeiungen. Alles wahr, alles so
passiert – keinerlei Zweifel. Da muss man schon eine gehörige Geistesarbeit
leisten, um die täglichen Zusammenstöße mit der Realität ohne Schäden am
Glaubensgebäude zu überstehen. Je größer die Anstrengung, desto stärker
hinterher das Gefühl der Scham, wenn man feststellt, das Denkvermögen eines
Grundschülers hätte ausgereicht um mehr als achtzig Prozent dessen, was man für
richtig hielt zu widerlegen.
BS: Gab es außer der Scham auch noch andere
Empfindungen?
ST: Selbstverständlich. Am Anfang vor allem
Zorn und Trauer.
BS: Auf wen waren sie zornig?
ST: In erster Linie auf mich selbst. Aber
natürlich auch auf meine Eltern, die mir das schließlich eingebrockt hatten.
Auch wenn sie überzeugt waren, das richtige zu tun, war es schlicht eine
Katastrophe für mich.
BS: Und die Trauer?
ST: Die gab es um all die verlorenen Jahre. Ich wollte als junger Mensch gerne studieren. Aber das wurde in der Gemeinschaft nicht gerne gesehen. Alles Intellektuelle war suspekt, hinter jedem Wissen, das nicht von innerhalb der Gemeinschaft stammte, lauerte der Teufel. Ich wurde Handwerker und stellte mich voll und ganz in den Dienst der Gemeinde. Und natürlich empfand ich auch Trauer um meine Familie, die, wie es von der Gemeinschaft erwartet wurde, jeden Kontakt zu mir abbrachen als ich mich von meinem Glauben lossagte. Zum Glück war ich auch in gleichem Maße wütend auf sie, sonst hätte mich die Trauer erstickt.
BS: Und heute, was ist für Sie heute das
vorherrschende Gefühl? Immer noch die Scham? Oder doch eher Trauer? Zorn?
ST: Neugier. Heute bin ich nur noch
neugierig. Sehen sie, es ist, als hätte ich die ersten vier Jahrzehnte meines
Lebens auf einer Insel verbracht. Die Leute auf der Insel waren sehr nett,
hatten aber Angst vor dem Meer, das sie umgab. Deswegen fuhr niemand zur See,
auch wenn im Hafen ein paar Boote lagen. Die Insel war karg und nur mit Mühe
konnte man so viel ernten, dass es zum Überleben reichte. Jeden Tag sah ich auf
das Meer hinaus, sah all die Schiffe, die an uns vorbeifuhren. Diese seien, so
wurde mir erzählt, voller böser Menschen auf dem Weg zu Teufel und Tod. Aber sehr
bald käme ein großes Boot und würde uns von der Insel weg in das Land bringen,
das alle „Das Paradies“ nannten. Dort würde Glück und Überfluss herrschen.
Eines Tages fand ich am Strand eine Flaschenpost. Sie stammte von jemanden, der
die Insel viele Jahre zuvor verlassen hatte. Er schrieb: „Nur die, die an Land
bleiben, haben Angst vor dem Meer“. Diese Worte gingen mir nicht mehr aus dem
Kopf. Und plötzlich begannen die Dinge sich zu verändern. Schaute ich sonst mit
Argwohn hinaus auf das Meer, erfüllte mich sein Anblick nun mit Sehnsucht.
Jetzt war es die Insel mit ihren Bewohnern, die mir Beklemmungen verursachte.
Und so beschloss ich zu gehen. Alle schlugen die Hände über den Kopf zusammen.
Zuerst waren sie traurig. Dann wurden sie wütend. Schließlich setzte ich mich
in eines der Boote. Ich wusste, ich könnte nie wieder zurück, hatte aber auch
keine Ahnung, was mich erwartete. Also ruderte ich los.
BS: Und wo sind sie am Ende gelandet?
ST: Ich rudere noch. Zwar habe ich dieses
oder jenes Schiff schon bestiegen, habe an einigen Häfen angelegt, aber
nirgendwo hat es mich auf Dauer gehalten. Immer gab es etwas, das mich an meine
Insel erinnerte und dann wollte ich wieder weg.
BS: Ist das nicht frustrierend. Nur
unterwegs sein und niemals ankommen?
ST: Vermutlich ist das Unterwegssein mein
Ankommen.
*
Das Lied „En la muelle de San Blas » der mexikanischen Band Maná handelt von einer Frau, deren Geliebter zu einer Seereise aufbricht. Er verspricht zurückzukehren und sie verspricht auf ihn zu warten. Und so steht sie Tag für Tag an der Mole und erhofft seine Rückkehr. Tausende Monde verstreichen, doch er kehrt nicht wieder. Sie aber steht an der Mole und blickt, weißhaarig mittlerweile, hinaus auf das Meer, in das sie sich längst verliebt hat. Die Bewohner des Hafenortes halten sie für verrückt. Eines Tages beschließen sie, die Frau von der Mole zu holen, um sie ins Irrenhaus zu bringen, aber keinem gelingt es die Frau zu bewegen, da sich ihr Körper mit der Mole verwurzelt hat, damit sie niemand mehr von ihrem geliebten Meer trennen könnte. Und so bleibt sie dort, alleine mit der Sonne und dem Meer.
*
Von Hweda aus stieß die Estralla in See, die karibischen Inseln als Ziel im Blick. An Bord zwölf Mann Besatzung und gut fünfhundert Sklaven als Fracht. Nach zwanzig Tagen geriet man in einen heftigen Sturm, der das Schiff und seine Bewohner schnell an ihre Grenzen brachte. Orlindo, der Steuermann erinnerte den Kapitän an das biblische Wort über Jona und empfahl die schwarze Ladung über Bord zu werfen. Wer weiß, sagte er, wieviel Zauberer wir in unserem Bauch mitschleppen. Der Kapitän, der eher mit den Berechnungen von Gewinn und Verlust vertraut war als mit biblischen Mythen, lachte Orlindo aus. Doch als er sah, wie angsterfüllt die Besatzung war, befahl er dem Steuermann in den Frachtraum zu steigen und aus der Schar der Sklaven zehn auszusuchen, die ihm am ehesten wie Zauberer oder Hexen dünkten. Nun hatte Orlindo noch nie in seinem Leben einen Zauberer oder eine Hexe gesehen, aber in seiner kaum über die Reling des Schiffes hinausreichenden Vorstellungskraft mussten es große und kräftige Männer und Frauen sein. In dem Frachtraum war es dunkel und es stank zum Gottserbarmen. Orlindo leuchtete jeder der Kreaturen mit der Laterne ins Gesicht, besah sich soweit möglich ihre Leiber und traf schließlich seine Wahl. Er ließ einen der Matrosen die Ketten lösen und die vermeintlichen Zauberer, sieben an der Zahl, und Hexen, derer drei, mit einem Strick binden. Derweil nahm der Sturm an Kraft und Geschwindigkeit zu. Orlindo hieß den Soldaten sich zu beeilen. Dann steigen sie unter großen Mühen an das wasserüberspülte Deck, wo die Matrosen sich ängstlich hinter dem Kapitän zusammengekauert hatten. Der besah sich die zehn Sklaven, registrierte ihre ausnehmend gute Gestalt und verringerte in Gedanken seinen Gewinn um eine beträchtliche Summe. Dennoch nickte er Orlindo zu als Zeichen, man solle die Teufelswesen über Bord gehen lassen. Diese hatten sich in der Zwischenzeit aber von ihren Fesseln befreit, ergriffen schnell was immer als Waffe sich darbot und noch ehe einer der Matrosen oder Orlindo oder gar der Kapitän reagieren konnten, waren sie entweder über Bord geworfen oder totgeprügelt worden. Bald darauf legte sich der Sturm.
Einer der Zehn, der in seiner Heimat tatsächlich ein Zauberer
und Heiler war, übernahm das Ruder. Ob er sie wieder nach Hause brächte,
fragten ihn die anderen, doch er schüttelte den Kopf. Jeder hier an Bord hätte
ein anderes zu Hause und die Häfen wären voll mit Menschen, die sie sofort
wieder gefangen nehmen und erneut in Ketten legen würden. Sie mussten, da war
er sich ganz sicher, einen anderen Ort finden, fern von allem, was sie bisher
kannten oder kennengelernt hatten. Dort würden sie Frieden finden. Wo dieser
Ort sei, wurde er gefragt. Er schaute zum Himmel, zeigte auf einen der hellsten
Sterne, die zwischen den Segeln hindurchleuchteten und sagte: dieser wird uns
dorthin führen.
Wochen vergingen. Der Stern führte sie immer weiter in den
Süden. Niemand an Bord war mehr gesund oder guten Mutes. Doch der Zauberer
hielt das Steuer. In seiner Heimat war sein Name Xiliranus gewesen. Jetzt aber
nannte er sich Nahodna. Eines Morgens, viele waren kurz davor zu sterben oder
sich aus Verzweiflung in das Meer zu werfen, sahen sie am Horizont den spitzten
Gipfel eines Berges. Jubel brach aus, man verneigte sich vor Nahodna und voller
Erwartungen schauten alle in Richtung des Berges, der immer näher zu kommen und
immer höher zu werden schien. Nebel dampfte aus seinem runden Gipfel. Ob dieser
Berg gefährlich sei, fragte die Frau, die während der ganzen Reise bei Nahodna
gestanden hatte und die der Zauberer sehr mochte, war sie es doch gewesen, die
mit einem Belegnagel Orlindo den Schädel zertrümmert hatte. Sie hieß Sali und kam aus der Gegend um Kasch.
Ihr Vater war ein König gewesen und sie hatte drei Zugehfrauen, mit denen sie
sich gerade am Fluss befand, als die Männer kamen und sie mitnahmen. Die Namen
der Frauen waren Ilai, Satafa und Nairè. Sie starben noch bevor man den Hafen
erreichte. Erst jetzt, wo Nahodna sie in die Freiheit führte, konnte Sali um
ihre Gefährtinnen trauern. Sie tat es, indem sie dem Zauberer nicht von der
Seite wich. Dieser hielt nun seinen Blick auf den Berg gerichtet und dachte
über Salis Frage nach. Dann schüttelte er den Kopf und sagte: Nicht für unsere
Seelen.
*
In einem kurzen Text über Borges aus dem Jahr 1976 schreibt
Cioran über sich selbst (er kommt ja immer, egal über wen er schreibt, auf sich
selbst zurück. Aber wem ergeht das nicht so?): „Niemals haben mich Denker
angezogen, die in einem einzigen Kulturraum eingefangen sind. Keine Wurzeln
schlagen, keiner Gemeinschaft angehören – das war und das ist meine Devise.
Fremden Horizonten zugewandt, habe ich stets wissen wollen, was sich anderswo
abspielte.“ In jeder Gemeinschaft gibt es jemanden, der von der Welt erzählt
ohne sie zu kennen und angsterfüllte Zuhörer findet. Die Kultur bangt grundsätzlich
um sich selbst. Deswegen braucht sie Schiffbauer. Da nie ein Meer in der Nähe
ist, übernehmen Schriftsteller diese Aufgabe und bauen Bücher statt Boote.
Reisen wie das Lesen lernen, von Kindheit an. Betrachtet jede Wurzel, die euch
an den Füßen wächst voller Zweifel und lauft sie schnell ab. Entgeht, solange
es möglich ist, der Gefangenschaft. Verliebt euch in den fremden Horizont.
Setzt euch in die Bücher und fahrt los. An Land warten die Nattern auf eure
weiche Haut. Ihr Biss verhärtet das Herz und engt den Blick bis zur Blindheit.
Bleibt, möchte man den Kindern zurufen, in den Booten und geht nur an Land um
zu lernen, nicht um zu bleiben. Hütet euch vor den Inseln mit ihren
kurzhalsigen Bewohnern. Vergesst nicht: Es gibt keinen Gott außer Wind und
Welle. Alles, was an Land angebetet werden will, hungert nach Blut.
Ausnahmslos. Bleibt, möchte man den Kindern zurufen, in den Booten. Das erste
Gedicht, das Borges veröffentlichte, 1919 in der Zeitschrift Grecia, hatte den
Titel „Hymne an das Meer“.
*
Der Urvater der drei großen Monotheismen, Aviram, bestieg niemals ein Schiff. Gesehen wird er das Meer haben, spätestens als er mit seiner Schwestergattin in Zoar (Ägypten) weilte. Vielleicht aber schon früher auf seiner Reise von Haran nach Damaskus. Es gibt Vermutungen, dass er sich für einige Zeit in Ugarit aufhielt. Der Gott aber, den er sich erdachte, war ein Gott der Wüste. Nun mag einem die Wüste wie das Meer vorkommen, grenzenlos, eingerahmt nur von einem Horizont, der in unerreichbar scheinender Ferne über dem Land schwebt und von den Reisenden viel abverlangend, gerne auch das Leben. Was aber der Wüste fehlt, ist das wimmelnde Leben unter seine Oberfläche, der sich unter den Waghalsigen ausbreitende Raum, der immer mitgedacht wird, wenn der Blick hinausgeht über die Oberfläche. Die Wüste ist kompromisslos, grausam und gut. Hier ist nur Platz für einen Gott. Dem Meer würde ein Gott niemals reichen. Es hat seinen Blick nach unten und nach oben gerichtet. Gott liebt die Wüste, das Meer aber liebt den Himmel. Es weiß, jeder der dort oben wohnt, tut dies nur für bestimmte Zeit. Die Wüste lässt seinen Gott weder alt werden noch sterben. Die Götter, die einst die Meere bewohnten sind schon lange tot. Nun müssen Wale und Delfine und Sonnenuntergänge reichen um die metaphysischen Bedürfnisanstalten zu versorgen. Im heißen Sand entsteht immer etwas, das sich wie Religion anfühlt. Das kalte Wasser dagegen schmeckt nach dem Salz der Vernunft und nach grundloser Tollheit. Der Mensch kommt aus dem Meer und Gott aus der Wüste. Dieser Gegensatz ist nur durch Gebot und Gewalt zu überbrücken.
*
Seit Samuel das Boot bestiegen hatte und davongerudert war, standen seine Mutter und sein Vater auf der schmalen Mole ihrer Insel und schauten hinaus auf das Meer. Die sie beobachteten sagten, sie trauerten um den Sohn. Andere wiederum behaupteten, die beiden hielten Ausschau nach dem großen Schiff, dessen Ankunft sie so sehnlich erwarteten. Ihr Glaube sei stark und ließe keine Trauer zu. Mehr denn je seien sie überzeugt, jeden Augenblick könne sich die Verheißung erfüllen. Das Leben auf der Insel ging weiter seinen eintönigen und entbehrungsvollen Gang, doch die beiden blieben an der Mole stehen, ergrauten mit jedem Tag mehr. Die Söhne und Töchter, die ihnen geblieben waren, hießen sie, doch in ihr Haus und zu ihrer Arbeit zurückzukehren. Alle brannten und glühten vor Hoffnung, aber das unentwegte Hinausstarren auf das Meer sei selbst für den gläubigsten Menschen nicht gut. Man müsse schließlich auch Geduld zeigen. Die Frau und der Mann jedoch bewegten sich nicht. Eines Tages beschlossen die Vorsteher der Insel, die beiden von der Mole zurück in ihr Haus zu bringen, notfalls mit Gewalt. Als sie sich jedoch anschickten, das alte Paar von der Mole zu holen, mussten sie feststellen, dass die beiden mit den Steinen verwachsen waren und ihrer beider Geist sich irgendwo auf dem Meer verloren hatte.